Zwischendurch!
Der grosse Schnitt
„Eigentlich geht es uns doch ganz gut.“ Diesen Satz hört man immer wieder. Und dann immer diese schrecklichen Nachrichten. „Flächenbrand in Euroland – Wer rettet unser Geld?“ – so hieß es schon Mitte Juli bei Fernseh-Talkerin Maybritt Illner. Und seitdem ist die Diskussion nicht leiser geworden.
Auch die Krise scheint jedoch ihre unterhaltsamen Seiten zu haben. Das Handelsblatt berichtete über die Maybritt-Illner-Sendung: „… eine Überraschung: Maybritt Illners Runde parlierte so blitzgescheit und witzig über Glanz und Elend der Einheitswährung wie die Besetzung eines Salons im Paris des 18. Jahrhunderts. So sorgten die überwiegend blendend aufgelegten Gäste mit rasanten Wortwechseln und spitzen Bonmots für eine ziemlich kurzweilige Sendung.“ Weiter heißt es im Handelsblatt: „Hans-Werner Sinn übernahm in dieser gut aufgelegten Runde die Rolle der Spaßbremse. Er warf besorgte Blicke über seinen Backenbart und erklärte, dass es nun wirklich an der Zeit sei, den Geldhahn zuzudrehen.“ Später heißt es: „Den Rest der Sendezeit saß der Ökonom mit trauriger Miene da und schüttelte hin und wieder den Kopf.“ Soviel zu Maybritt Illners Sendung aus dem Juni.
Die Rezeption dieser Sendung blieb mir in Erinnerung, weil der Vergleich mit den Pariser Salons des 18. Jahrhunderts so gut passte. Die bürgerliche Kritik am absolutistischen Regime, die sich in den Pariser Salons entfaltete, war witzig und intellektuell anspruchsvoll. Noch heute zitieren Staatsrechtler, Literaten und Philosophen, was damals Kluges gesagt wurde. Wikipedia schreibt über Voltaire: „Seine Waffen im Kampf für seine Vorstellungen waren ein immenses Wissen, Phantasie, Einfühlungsvermögen, ein präziser und allgemein verständlicher Stil sowie Sarkasmus und Ironie.“
Historiker schreiben, die Gesellschaft im vorrevolutionären Frankreich sei eigentlich recht wohlhabend gewesen. Auch in den Pariser Salons hätte man sagen können: „Eigentlich geht es uns doch ganz gut.“ Sicherlich waren die Portfolios und die Altersvorsorge von Bürgertum und Adel etwas zu einseitig ausgerichtet: es dominierte der königliche Schatzbrief. Mit rund 75 Prozent des BIP war der König bei seinem Volk verschuldet. Und Dank königlicher Zinsen wuchsen die Beträge auf den Konten der Sparer immer weiter an.
Die Schulden des Staates waren die dominante Sparform wohlhabender Franzosen.
Als in Island ein Vulkan ausbrach, dessen Aschewolken in Nordeuropa drei Jahre lang Kälte, Hunger und Missernten auslösten, rächte sich die einseitige Anlagestrategie der Franzosen. Sie wollten ihre Schatzbriefe verkaufen, aber es gab niemanden, der sie hätte kaufen können. Auch der König konnte keine Zinsen zahlen – bisher konnte er nur Kredite umschulden und Zinsen zahlen, weil er neue Schatzbriefe ausgegeben hatte. Als es keine neuen Nachfrager gab, kollabierte das System.
Voltaire musste das nicht mehr miterleben. Er starb ein paar Jahre vor der Revolution. Seine spitz formulierte Einschätzung über Zukunft des Papiergelds bewahrheitete sich jedoch. „Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.“ Nachdem die Finanzierung durch Schuldscheine nicht funktionierte, erprobten die Finanzpolitiker der Revolution eine Finanzierung durch die Notenpresse. Die ersten Versuche waren ermutigend, die Weiterführung des Gelddruckens führte dann jedoch direkt in eine Hyperinflation. Obwohl Goldmünzen Kaufkraft bewahrten, erwiesen sich Kaufkraftüberlegungen in diesen Jahren als nebensächlich. Die eigentliche Herausforderung während der Revolutionsjahre blieb, nicht in völlige Kopflosigkeit zu verfallen.
Zurück zu den französischen Staatsschulden. Wie konnte die französische Staatsverschuldung so außer Kontrolle geraten? Weil der König Kriege führte und das Geld verprasste? Der jahrelange Verfassungsrichter Paul Kirchhof, einer der renommiertesten Experten für Verfassungs- und Steuerrecht, gibt in der FAZ eine einfache, generelle Antwort zum Thema Staatsschulden: kein Staat kann strukturell Schulden aufnehmen oder tilgen. Wörtlich heißt es:
„Moderne Verfassungen verstehen den Kredit als ein Instrument der Wirtschaft, die mit dem Darlehen ihre Produktivität steigert und daraus den Kredit bedienen kann. Die Verschuldung ist aber grundsätzlich kein Finanzierungsmittel des Staates, weil der Staat strukturell keine ökonomischen Gewinne erwirtschaftet, aus denen er Tilgungs- und Zinszahlungen finanzieren könnte.“
In Mexiko, Russland und Venezuela besitzt der Staat Rechte an der Ausbeutung von Öl-, Gas- und Erzreserven, die Dank einer Laune Gottes innerhalb ihrer Staatsgrenzen liegen. Solche Staaten können strukturell Gewinne erwirtschaften und Zinsen zahlen. Der Normfall ist jedoch, wie Prof. Kirchhof erklärt, dass ein Staat strukturell keine Gewinne erwirtschaften kann, keine Zinsen zahlen kann und deshalb auch keinen Kredit aufnehmen darf.
Die gegenteilige Meinung äußerte jüngst Noch-Notenbankchef Trichet, der erklärte, dass Griechenland nicht pleite gehen darf, da unser Finanzsystem und seine regulatorische Ausgestaltung darauf fußen, dass Staatsanleihen nicht ausfallen können. Basel III müsste komplett überarbeitet werden, wenn Staaten doch pleite gehen können. Soweit Trichet.
Wer hat Recht? Kirchhof oder Trichet? Aufmerksame Vermögensverwalter werden registrieren, dass die beiden hochgebildeten Herren die Rolle von Staatsschulden völlig verschieden bewerten.
Zu den aktuellen Ereignissen: Auf dem medial viel beachteten EU-Gipfel vom Mittwoch wurde festgelegt, dass Banken gezwungen werden, einen freiwilligen Haircut von 50% auf ihre griechischen Anleihen zu akzeptieren. Auf diese Weise sollen die griechischen Staatsschulden bis 2020 auf einen Stand von 120 Prozent des BIP zurückgeführt werden.
Die Schulden Griechenlands bei der EZB und Partnerländern bleiben von diesem Schuldenschnitt unberührt.
Unklar bleibt, warum für Griechenland eine Verschuldung von 120 Prozent des BIP tragfähig ist, während Russland 1998 bei einer Staatsverschuldung von 28 Prozent des BIP den Bankrott erklären musste.
Auch die Bundesrepublik war einst in einer Schuldenkrise. Schwer trug der junge Staat an den Lasten der Vergangenheit, den Kriegsschulden und Vorkriegsschulden. Mit 30 Milliarden D-Mark, das war 1953 unvorstellbar hohe Summe, stand die Bundesrepublik in der Kreide. Im Rahmen der Londoner Schuldenkonferenz gelang es den deutschen Verhandlungsführern, die Schuldenlast um zwei Drittel zu reduzieren. Die Amerikaner wollten den Deutschen noch mehr erlassen, aber die Briten waren selbst hoch verschuldet und benötigten die deutschen Zahlungen. Heute werden Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt, um die Zahlen fassbar zu machen.
Die Bundesrepublik ging mit einem Schuldenstand von 20,8 Prozent des BIP in die Londoner Schuldenkonferenz und konnte 1953 einen Haircut aushandeln, der die Schulden auf 6,95 Prozent des BIP senkte.
Im Rahmen dieser Londoner Schuldenkonferenz verzichtete übrigens auch Griechenland auf den größten Teil seiner Forderungen gegenüber Deutschland.
Als der deutsche Verhandlungsführer Abs die Schulden der Bundesrepublik per Haircut auf 6,95 Prozent des deutschen BIPs reduzierte, galt das in Deutschland als schlechtes Ergebnis. Man hatte sich von den Verhandlungen mehr erhofft. Besorgte Stimmen zweifelten, ob Deutschland diese immensen Schulden werde tragen könne.
Dieser Blick in die Vergangenheit schärft den Blick für aktuelle Ergebnisse der europäischen Schuldenkrise. Wird die viel beachtete Vereinbarung vom Mittwoch in Brüssel die Balance zwischen Schuldansprüchen und Realwirtschaft wieder herstellen? Der historische Kontext spricht da eine ganz eigene deutliche Sprache.
Immerhin: Paul Kirchhofs Aufsatz in der FAZ trägt den Titel „Jeder Schuldschein sei zerissen.“ Da scheint sich eine Richtung anzudeuten.
Nur ganz nebenbei sei erwähnt, dass Gold die einzige Geldform ist, die frei von Schulden ist. Aber wie sagte Voltaire so schön: „Es kann gefährlich sein, richtig zu liegen, wenn die Regierung falsch liegt.“ Gold wird seinen Weg gehen, aber eine ordentliche Diversifikation mit weniger exponierten Vermögensformen (Silber, Zucker) kann nicht schaden.
Irgendwo habe ich dieser Tage gelesen, dass auch ein EU-Finanzminister gesagt haben soll, dass die Rettungsschirme mit immer neuen „Shock and Awe“-Milliardensummen nicht verbergen können, dass die Regierungen gar kein Geld haben. Da ist etwas dran.
Bemerkenswert und medial unbeachtet ist der Fakt, dass die Anleihen des Europäischen Rettungsschirms EFSF inzwischen 1,4 Prozent über den Anleihen des Bundes mit gleicher Laufzeit notieren.
Beachtung sollte dieser Tage ebenfalls die Einschätzung finden, mit der der führende Ratingsriese S&P die Schuldentragfähigkeit Großbritanniens einschätzt. Der Schuldenstand des Königreiches stieg per Mai 2011 auf 151,4 Prozent des nominalen BIPs. Der Blog „Querschüsse“ errechnete, dass rund 60 Prozent der Schulden aus der Übernahme und Stützung von Banken kamen. 2011 wird das britische Staatsdefizit bei 8,6 Prozent des BIP liegen. Das sind griechisch-portugiesische Dimensionen. Und um es in einen historischen Kontext zu setzen: Britannien addiert zu seinen Schulden pro Jahr mehr, als die gesamte Verschuldung der Bundesrepublik 1953.
Umso erfrischender ist die Nachricht, dass S&P die Topbonität Britanniens von AAA bestätigt. Dem industriell weitgehend entkernten Inselreich wird von Standard & Poors eine „gesunde, offene und diversifizierte Volkswirtschaft“ bescheinigt.
Ich bin mir nicht sicher, was dieses skurrile Lob für Britannien bedeuten soll. Ein Zufall ist es nicht. Wird hier versucht, einen sicheren Hafen zu installieren, in dem Kapital die Stürme der Euro-Krise überstehen kann?
Der eigentliche sichere Hafen, Gold, hat in der letzten Woche wieder Preise um 1750 Dollar erzielt.
Der Preisrutsch um den 23.9.2011 wurde durch Erhöhungen der Zahlungsanforderungen an der COMEX ausgelöst.
Eine Grafik der Commerzbank zeigt optisch sehr deutlich, wie ein Stakkato von Margin-Erhöhungen die Barzahlungsanforderungen in kurzer Zeit fast verdoppelte – und zu Zwangsliquidationen von Gold-Futures führte.
In den vergangenen Tagen erhöhten sich die Zuflüsse zu den Gold-ETFs.
Das könnte ein Zeichen sein, dass der Markt die Korrektur verdaut hat.
Quelle: B.Meyer, Meyers Goldwoche
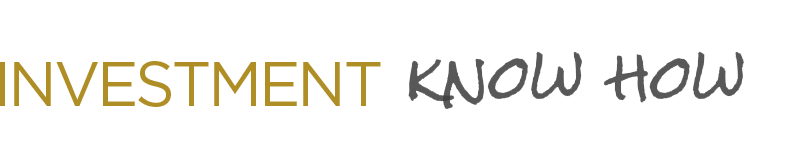

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!