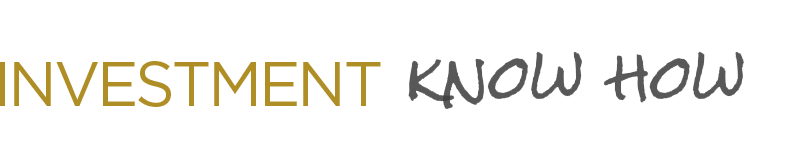2014 im Rückblick
/in Zwischendurch!Die WordPress.com-Statistik-Elfen haben einen Jahresbericht 2014 für dieses Blog erstellt.
Hier ist ein Auszug:
Eine Cable Car in San Francisco fasst 60 Personen. Dieses Blog wurde in 2014 etwa 1.900 mal besucht. Eine Cable Car würde etwa 32 Fahrten benötigen um alle Besucher dieses Blogs zu transportieren.
Zwischendurch!
/in Zwischendurch!Holger Schmitz: „Der niedrige Goldpreis ist ein Geschenk für Anleger“
Holger Schmitz, Vorstand von Schmitz & Partner
Der Goldpreis hat bis Ende Juni eine beispiellose Talfahrt vollführt. Fundamental ist dieser Preisrutsch allerdings nicht zu begründen. Denn weder hat sich die politische Lage im Hinblick auf die Schuldenkrise verändert, noch gibt es Einbrüche oder Aufschwünge bei anderen Anlageklassen, schreibt Holger Schmitz, Vorstand von Schmitz & Partner.
Die massiven Goldverkäufe auf den Terminmärkten wirken verunsichernd auf Anleger – davon profitieren Politik und Notenbanken. Gleichzeitig werde an den Kassamärkten sehr viel gekauft, allen voran von den Notenbanken.
Anleger tun daher gut daran, sich nicht beirren zu lassen und weiterhin auf Gold zu setzen. Angesichts der niedrigen Preise sei das gelbe Edelmetall im Moment sogar eine besonders günstige Anlageform – und eine mit Zukunft, denn das Vertrauen in die Papierwährungen und allen voran den Euro sinkt weiterhin.
Nach einer langen Aufwärtsphase ist der Goldpreis im letzten Quartal dramatisch eingebrochen. Auslöser waren massenhafte Verkäufe an den Terminmärkten Mitte April – innerhalb von nur wenigen Tagen wurde hier beinahe die gesamte Jahresproduktion von Gold verkauft.
Einen so starken Preisrückgang innerhalb eines Quartals hatte es seit 1920 nicht mehr gegeben. Ende Juni rutschte der Preis auf Sicht von zwölf Monaten sogar auf den bisherigen Tiefststand von rund 1.200 Dollar.
Beinahe zeitgleich machte ein anderes Ereignis Schlagzeilen: der Kauf von physischem Gold in großen Mengen durch die Zentralbanken – so viel, wie seit 1964 nicht mehr, und so viel, dass es an den Kassamärkten derzeit zu Lieferengpässen kommt.
Eine breite Öffentlichkeit erfuhr davon durch eine der weltweit größten Banken: Die niederländische ABN Amro informierte am 1. April ihre Kunden, dass ab sofort die physische Auslieferung von Gold, Silber und Platin nicht mehr möglich sei. Stattdessen wurde ein Ausgleich in Cash angeboten.
Zusammengenommen lassen die Verkäufe auf den Terminmärkten und die Käufe auf den Kassamärkten den Verdacht aufkommen, dass es sich hier um ein abgekartetes Spiel handelt. Dabei werden die Anleger, die jetzt ihre Edelmetalle aufgrund der niedrigen Preise abstoßen oder von Käufen absehen, die Verlierer sein.
Die Zentralbanken seien hingegen die Gewinner, und möglicherweise sind sie auch die Initiatoren. Denn: Als Anlage ist Gold nur dann interessant, wenn der Preis steigt oder steigen wird. Fällt die Preiserwartung, geht auch das Interesse der Anleger zurück. Preisrückgänge können bewusst initiiert werden, nämlich durch gezielte Verkäufe an den Terminmärkten.
Im aktuellen Fall sei durch die massiven Verkäufe eine plötzliche und extrem starke Abwärtsbewegung des Goldpreises erreicht worden, die wiederum zur Folge hat, dass private und institutionelle Investoren den Markt verlassen.
Zentralbanken profitieren vom niedrigen Goldpreis
Allein die Zentralbanken kaufen weiter fleißig Gold. Aktuell besitzen sie insgesamt rund ein Fünftel des jemals geschürften Goldes, rund 31.671 Tonnen.
Die größten Vorräte finden sich in den USA und Deutschland: Mit 8.133 beziehungsweise 2.291 Tonnen haben beide Länder einen überproportionalen Anteil an den weltweiten Goldreserven.
In Deutschland kommt nun noch eine weitere interessante Entwicklung dazu: Das Gold, das über Jahrzehnte vor allem in ausländischen, insbesondere US-amerikanischen Tresoren lagerte, wird wieder zurückgeholt.
Ein künstlich gedrückter Goldpreis, massive Goldkäufe der Zentralbanken sowie die Rückholung des deutschen Goldes ins eigene Land: Bereitet sich Deutschland auf ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Papiergeld vor? Möglicherweise sind dies bereits die ersten Schritte zur Einführung einer neuen, weltweiten Währung, die – nach dem Crash von Euro und Dollar – zumindest teilweise wieder goldgedeckt sein wird.
Angesichts der Tatsache, dass Euro und US-Dollar bereits heute durch den lockeren Umgang mit der Notenpresse durch die Europäische Zentralbank EZB und die US-Notenbank Fed weitgehend ausgehöhlt sind, kann das ein durchaus realistisches Zukunfts-Szenario sein.
Euro-Schuldenkrise: Wachstum ist erst nach der Entschuldung möglich
Denn die Schuldenkrise in Europa ist, auch wenn sie derzeit weniger in den Schlagzeilen steht als noch vor einigen Monaten, nicht vorbei. Ganz im Gegenteil: Europas Schulden sind weiter gestiegen. Zwar ist das Tempo der aktuellen Neuverschuldungen nicht mehr so hoch, die bereits vorhandenen Schulden steigen aber weiterhin.
Der Ruf nach Schuldenschnitten wird daher immer lauter, insbesondere in Bezug auf Griechenland – denn allein durch wirtschaftliches Wachstum ist die Krise nicht in den Griff zu bekommen.
Erst wenn es eine nachhaltige Entschuldung gegeben hat, wird Wachstum wieder möglich sein.Und das geht nur über Schuldenschnitte, Eurobonds und eine Bankenunion. Wer dabei am tiefsten in die Tasche greifen muss, ist klar: Deutschland.
Was bedeutet all das für die Anleger? Im Hinblick auf die Aktienmärkte gehen wir davon aus, dass die internationalen Märkte bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus weiter zulegen können – wenn auch unter Schwankungen. Gleichzeitig setzen wir auf Gold.
Gerade in Zeiten wie diesen ist Gold eine erprobte Versicherung gegen den Missbrauch der elektronischen Notenpresse. Die günstigen Preise sind ein wahres Geschenk für diejenigen, die auf langfristigen Werterhalt setzen. Deshalb hat der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds die Gold- und auch die Silberpositionen zuletzt deutlich aufgestockt.
Zwischendurch!
/in Zwischendurch!
Interview mit Professor Wilhelm Hankel
Die Neue Luzerner Zeitung publizierte in der heutigen Ausgabe vom Dienstag, 8. Januar 2013, ein bemerkenswertes Interview mit dem deutschen Ökonomen und Euro-Kritiker der ersten Stunde, Prof. Dr. Wilhelm Hankel. Auf einer ganzen Seite an prominenter Stelle führt der Journalist Kari Kälin ein Interview, das es wahrlich in sich hat. Es ist eine Wohltat zu lesen, mit welch messerscharfem Sachverstand Wilhelm Hankel das Euro-Desaster analysiert und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt.
Interview Kari Kälin:
Wilhelm Hankel, wie ginge es Deutschland und den Euroländern heute ohne Euro?
Wilhelm Hankel: Glänzend. Deutschland stünde wirtschaftlich besser da als die Schweiz. Die meisten Euroländer befänden sich heute nicht in einer Krisensituation.
Weshalb?
Hankel: Wir hätten eine Reihe von Wechselkursbereinigungen und Währungsaufwertungen in Staaten wie Deutschland, Österreich oder den nördlichen Ländern erlebt. Wir hätten die Inflationsgefahr im Griff. Die südlichen Krisenstaaten befänden sich dank Abwertung der eigenen Währung auf dem Weg zur Genesung. Die griechische Drachme hätte an Wert verloren. Heute gilt die Unsinnsgleichung, dass ein Euro in Griechenland so viel Wert ist wie in Deutschland. Doch die Kaufkraft liegt in Griechenland gemäss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) um 40 Prozent tiefer als in Deutschland. Mein Fazit: Ohne Euro ginge es ganz Europa besser. Die Gemeinschaftswährung hat die heutige, katastrophale Lage heraufbeschworen.
Ist der Euro noch zu retten? Oder steht er am Abgrund?
Hankel: Wahnsinn kann man nur eine gewisse Zeit lang betreiben. Was die Schweizerische Nationalbank mit den Eurokäufen macht, betreibt die EU auf monströse Weise im Grossen. Während die Schweizerische Nationalbank «nur» den Wechselkurs stabilisieren will, «rettet» die EU auf noch monströsere Weise ganze Volkswirtschaften und hält sie künstlich auf einem Stand, den sie längst nicht mehr haben. Aus währungs- und finanzpolitischer Sicht sind Staaten wie Griechenland, Spanien, Portugal bankrott. Die Euroretter vollführen eine Bankrottverschleppungspolitik, die sich nicht auf alle Ewigkeit aufrechterhalten lässt. Sie ist nicht zu bezahlen. Die Summen, die im Spiel sind, sind viel zu gross. Die Gesamtverschuldung in der südlichen Eurozone beläuft sich auf rund 13 Billionen Euro. Das entspricht viermal der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands.
Sind die Sparprogramme, welche die Troika Griechenland aufzwingt, nicht zielführend?
Hankel: Nein. Hier wird ein Patient quasi ohne Betäubung operiert. Die Euroretter erwarten auch noch, dass die Menschen die Einbussen bei den Einkommen, Renten und Sozialleistungen klaglos hinnehmen. Man kann aber gerade jungen Menschen nicht eine Zukunft ohne Perspektiven, ohne Aussicht auf eine Arbeit, zumuten. Wäre Griechenland nicht in der Eurozone, hätte es seine Währung schon vor Jahren abwerten und eine vernünftige, nationale Wirtschaftspolitik mit eigenen Wechselkursen und eigenen Zinsen verfolgen können. Die heutige Situation führt zum Beispiel dazu, dass Griechenland im eminent wichtigen Tourismussektor aus Kostengründen viele Kunden an die Türkei verloren hat. Athen wird von Brüssel fremdbestimmt.
Sie haben den Euro schon als «lebenden Leichnam» und Missgeburt bezeichnet. Dramatisieren Sie? Momentan herrscht an den Märkten ja eine relative Ruhe.
Hankel: Die Ruhe an den Märkten ist vergleichbar mit der Selbstberuhigung eines Selbstmörders, der von einem Turm springt und sich während des freien Falls sagt: «Es ist ja noch nichts passiert.» Das ist reiner Selbstbetrug.
Sehen Sie einen Ausweg aus der Eurokrise?
Hankel: Ich verrate meine konkreten Vorschläge, die ich an meinem Vortrag vom nächsten Samstag in Luzern präsentieren werde, noch nicht en détail. Die Ironie ist: Man könnte den Euro retten, indem man ihn in Kombination mit nationalen Währungen weiterführt, in einem Verbundsystem mit den von ihm verdrängten alten Währungen. Der Euro wäre dann wie im alten Goldstandard: das «Gold Europas». Wenn auch nur aus Papier oder elektronischer Materie und nicht aus dem gelben Metall. Der Euro konnte niemals nationale Währungen ersetzen, er konnte nur als Alternativwährung fungieren, eben wie früher das Gold im Goldstandard. Kehrte man dahin zurück, hätte das mehrere Vorteile. In der EU verschwände der Graben zwischen Ländern mit und ohne Euro. EU und Eurozone wären identisch. In Kombination mit der nationalen Währung könnten sogar Länder wie die Schweiz, England, Russland oder Norwegen zu Euroländern werden.
Wenn die einzelnen Staaten zu ihren Währungen, also zum Beispiel die Griechen zur Drachme, zurückkehren, hätte das doch verheerende Folgen. Die Griechen würden bei der Ankündigung dieses Schrittes zur Bank rennen und sofort ihre Guthaben sichern.
Hankel: Im Gegenteil: Die Aussicht auf Wiedereinführung der alten Währungen würde einen Freudenrausch auslösen. Nicht nur in Deutschland, wo die D-Mark fast so ein Mythos ist wie der alte Kaiser im Kyffhäuser. Man müsste den Menschen nur klarmachen, dass es sich um einen Währungs-umtausch handelt und nicht um eine Währungsreform. Und dass dieser Umtausch nicht mit einer Wertverminderung ihrer Guthaben einhergeht.
Hat der Euro nicht auch gute Seiten? Die mühsamen Wechselkurse entfallen, Touristen müssen nicht andauernd in die Wechselstube. Das ist doch unter dem Strich praktisch.
Hankel: Jede Bequemlichkeit hat ihren Preis – auch diese. Im Falle des Euros ist der Preis auf Dauer unbezahlbar. Ausserdem ist diese Bequemlichkeit billiger zu haben: am Geldautomaten im Ausland. Er kann inzwischen umrechnen.
Was ist Ihrer Ansicht nach das Grundübel am Euro?
Hankel: Der unverantwortliche Leichtsinn, mit dem Politiker zwingende ökonomische – und menschliche – Gesetze ignoriert haben. Ökonomisch ist es widersinnig, dass sich Staaten mit unterschiedlichen Volkswirtschaften eine Währung teilen. Staat und Währung gehören zusammen. Was versteht denn eine «staatenlose» Zentralbank wie die EZB von den Problemen der ihr anvertrauten 17 Länder? Die sind doch in Griechenland anders als in Deutschland oder der Schweiz. Und: Was bei 17 Euro-Ländern nicht funktioniert, wie soll denn das, wie vorgesehen, bei 28 EU-Ländern klappen? Und dann die menschliche Seite. Die Menschen manifestieren ihre Bedürfnisse mit dem Geldschein. Er lässt erkennen, was sie wirklich wollen, und auch was nicht. Man sieht es jetzt an der Flucht aus dem Euro – nicht nur in den Krisenländern der Eurozone. Einer der grossen Ökonomen der Wiener Schule: Eugen von Böhm-Bawerk, Lehrer des heute viel zitierten Friedrich August von Hayek, hat das bereits vor 100 Jahren in seinem grundlegenden Essay «Macht oder ökonomisches Gesetz?» klar gelegt. Eine Politik, die gegen ökonomische Gesetze und damit gegen menschliche Grundbedürfnisse regiert, zieht immer den Kürzeren. Diese Erfahrung machen derzeit auch die Euroretter. Nur, sie hätten sie sich – und den Menschen, für die sie da sind – ersparen können. Was jetzt passiert und noch passieren wird, war auch schon vorher klar.
Hatten diverse Staaten nach der Wiedervereinigung nicht einfach zu viel Angst vor einem starken Deutschland mit einer starken D-Mark?
Hankel: Noch bevor 1992 der Vertrag von Maastricht über die EU unterzeichnet wurde, forderten Giulio Andreotti, Margaret Thatcher und François Mitterand, die Staatchefs von Italien, Grossbritannien und Frankreich, den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl dazu auf, der Währungsunion beizutreten. In einem Brief schrieben sie, ein zu starkes Deutschland mit einer zu starken Währung störe Europa und könne nicht hingenommen werden. Nachdem der Euro eingeführt worden war, hat Frankreich als erstes Land die Stabilitätsregeln gebrochen und ein zu hohes Staatsdefizit gemacht. Deutschland zog mit, vermutlich aus Solidarität, damit Paris nicht allein als schwarzes Schaf dastand. Das war eine politische Dummheit der damaligen rot-grünen Regierung.
Sie haben 1998 vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht gegen die Einführung des Euro geklagt. Danach hatten Sie Pariastatus. Der Spiegel bezeichnet Sie als «renitenten Professor». Wie haben Sie das erlebt?
Hankel: Der Kreis meiner Fans hat sich verändert. Die Politiker meiden mich. Aber wenn ich irgendwo im Café sitze, setzen sich Menschen spontan zu mir. Ich bin mit diesem Tausch zufrieden. Politiker und Medien schneiden mich, das Volk schätzt mich. Meine Homepage wird tausendfach angeklickt. Die Menschen honorieren meinen Einsatz für sie, Deutschland und Europa. Das tut mir gut.
Die Einführung des Euros konnten Sie nicht verhindern.
Hankel: Natürlich nicht. Aber leider haben sich alle Befürchtungen, die ich zusammen mit Wissenschaftskollegen vorgebracht habe, erfüllt. Entgegen dem Eindruck in der Öffentlichkeit haben wir durch unsere Verfassungsklagen doch einiges erreicht. So hat das Gericht festgehalten, dass die Eurozone eine «Stabilitätsgemeinschaft» sein muss. Wenn dies nicht der Fall sei, habe jede deutsche Regierung das Recht, die Währungsunion wieder zu verlassen. Mit unserer zweiten Klage gegen den Euro-Rettungsfonds EFSF haben wir im Mai 2010 einen weiteren Teilerfolg erzielt, als es um die Hilfen an Griechenland ging. Das Gericht hat festgelegt, dass die Regierung nicht «auto-matisch» Budgetüberweisungen vornehmen darf. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss jeweils vorher das Plazet des Parlaments einholen. Das verstand sich nicht von selbst. Und ausserdem gibt es dank diesem Urteil keine Eurobonds, also keine EU-Staatsanleihen.
Sie haben im letzten Sommer auch gegen den dauerhaften Rettungsschirm (ESM) geklagt.
Hankel: Das Hauptverfahren steht noch aus. Dann wird das Gericht auch prüfen, ob die Europäische Zentralbank unbeschränkt Schrottanleihen kaufen darf oder ob das den Rahmen der europäischen Gesetzgebung sprengt. Wir sind zuversichtlich. Unser bester, wenn auch unfreiwilliger Verbündeter ist der europäische Gerichtshof (EuGH). Seine Rechtsbrüche und -verdrehungen sind so unglaublich, dass sie das deutsche Verfassungsgericht gar nicht hinnehmen kann. So hat der EuGH zum Beispiel für rechtens erklärt, dass Eurostaaten für andere Eurostaaten haften – obwohl es die EU-Verträge in der No-Bailout-Klausel strikt verbieten. Doch der EuGH «hilft» den Rettern, indem er die damit verbundenen Milliardenzahlungen als «normale Kredite» interpretiert. Das ist ungeheuerlich. Denn dieses Geld finanziert keine realen Investitionen, es verschwindet in schwarzen Löchern.
Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) hat Sie wegen Ihrer Kritik am Euro als geschichtslosen Fachidioten hingestellt. Was sagen Sie ihm jetzt?
Hankel: Wenigstens hat er mir nicht die Fachkompetenz bestritten. Im Übrigen: Er hat Deutschland nur Geld gekostet hat, während ich mit dem «Bundeschätzchen», das ich in meiner Zeit als Leiter der Abteilung «Geld und Kredit» im Bundeswirtschaftsministerium Ende der 1960er-Jahre erfunden habe, der Staatskasse mehrere 100 Milliarden D-Mark eingebracht habe. Es war unser markwirtschaftliches Gegenstück zum «Volkseigentum» der früheren DDR. Der Bürger wurde mit seinen Spargroschen am Staatsvermögen beteiligt und erhielt dafür – als Quittung – ein gut und progressiv verzinstes, kursschwankungsfreies Wertpapier. Es war fast ein halbes Jahrhundert lang der Renner am deutschen Kapitalmarkt. Ausserdem wurde es x-fach imitiert: von Sparkassen, Volksbanken usw. Leider hat die Bundesregierung jetzt zu Jahresende seinen Vertrieb eingestellt, nachdem sie es schon während der letzten Jahre kaum noch verzinst hat. Es ist eine kolossale Dummheit, denn gerade jetzt kommt es darauf an, möglichst grosse Teile der Staatsschuld im Lande zu behalten – und der Bundesschatzbrief war das ideale Papier dafür.
Heute sind Sie ein viel geladener Redner, im deutschen Politmagazin «Cicero-Liste» figurieren Sie auf der Liste der 500 bedeutendsten deutschen Intellektuellen. Eine Genugtuung?
Hankel: Ja. Aber es ehrt die Juroren. Sie zeigen, dass sie Kritiker respektieren und nicht auf jeden Phrasendrescher reinfallen.
Die europäischen Staatschefs eilen von Krisengipfel zu Krisengipfel und sprechen Abermilliarden zur Rettung von Pleitestaaten wie Griechenland. Was bewirkt dieser Aktivismus überhaupt?
Hankel: Die deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft hat das Wort «Krisenroutine» zum Unwort des Jahres gekürt. Das Skandalöse ist, dass die Politiker nicht schlecht von ihrer Krisenroutine leben. Die Spesen sind gewaltig. Nur wofür? Die Krisenroutiniers zeigen mit jedem ihrer Gipfel einmal mehr, dass sie gar kein Konzept zur Lösung der Eurokrise haben. Sie verschleudern Billionen Euro, ohne eine Bilanz vorzulegen, aus der klar ersichtlich wäre, wofür. Seit Ausbruch der Eurokrise hat allein die Europäische Zentralbank rund 5 Billionen Euro gedruckt. Oder elektronisch verschickt. Ein materieller Gegenwert dafür ist nirgends zu erkennen. Im Gegenteil: Die Wirtschaftsleistung der Eurozone geht zurück. Es handelt sich also um Geldschöpfung ohne Wertschöpfung. Tatsächlich sind die 5 Billionen sind in den Bankenapparat der Eurozone geflossen. Die Banken haben das Geld mangels ausreichender Kreditnachfrage an der Börse angelegt. Die Frage, die sich jeder stellen muss, lautet: Wann kommt der nächste Schwarze Freitag? Es gibt genügend Parallelen zu den 1920er-Jahren. Auch damals wurde die Geldmenge bei mässigem Wachstum zu stark ausgeweitet. Irgendwann platzt die Blase, weil jemand zu viele Posten auf einmal verkaufte und die Kurse einbrachen, an jenem ominösen Freitag teilweise um bis zu 90 Prozent. Das kann sich wiederholen.
Hat überhaupt noch jemand den Überblick über all die Konstrukte, dank denen die Krisenstaaten der Eurozone aus dem Schuldensumpf finden sollen?
Hankel: Nein. Und ich frage mich, ob dahinter nicht Absicht steckt. Wenn jemand den Überblick hätte, wäre das Entsetzen über die verschwundenen Billionen ja noch grösser. Die Verschleierung ist Teil der Politik der Euroretter. Kämen die ganzen Konsequenzen dieser Übung ans Tageslicht, sie wäre schnell beendet. Gibt es einen intelligenten Politiker, der längst erkannt hat, dass ein Abbruch der Eurorettung nötig wäre? Ich sehe keinen. Leider gibt es genug dumme Politiker in Europa, die die Augen zu und weiter machen.
Sind diese Rettungsschirme denn nicht eine Art Marschallplan wie nach dem Zweiten Weltkrieg, dank denen die verschuldeten Staaten wieder auf die Beine kommen könnten?
Hankel: Ich arbeitete als junger Volkswirt im deutschen Marshall-Plan-Ministerium, als dieser Plan umgesetzt wurde. Der Marshallplan ist der Beweis für die klassische Theorie, dass man Kapital nur durch Arbeit bilden kann. Und dass man, um arbeiten zu können, genügend zu essen haben muss. Um aufzubauen, muss man etwas leisten. Die Eurorettung funktioniert nach dem umgekehrten Prinzip: Geld ohne Leistung. Es wird ein Status quo zementiert. Leider ist es der der Pleite.
Die Schweizerische Nationalbank kauft grosse Mengen an Euro – Ende November sass sie auf einem Devisenbestand von 174 Milliarden Euro – um den Wechselkurs von 1.20 zu verteidigen. Können Sie das nachvollziehen?
Hankel: Ich liebe die Schweiz, aber verstehe die panische Furcht der Schweizer Behörden vor der Aufwertung des Frankens nicht. Sie ist völlig unberechtigt. Die D-Mark hat in ihren letzten 25 Lebensjahren ständig aufgewertet. Deutschland wurde in dieser Zeit nicht ärmer, sondern immer reicher. Das würde auch in der Schweiz passieren. Wer exportiert, muss auch importieren. Die Importe werden bei einer starken Währung ständig billiger, auch für Wirtschaft und Industrie. Sie gewinnt an Wettbewerbsfähigkeit. Mein früherer Chef, Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller von der SPD, sagte damals: Jede DM-Aufwertung ist eine Ausschüttung von «Sozial-Dividende an das deutsche Volk». Man kann sich mehr im Supermarkt kaufen und reist günstiger ins Ausland. Das gilt auch für die Schweiz. Die Schweizerische Nationalbank verschwendet Volksvermögen, wenn sie Geld in einer Währung anlegt, die es wahrscheinlich schon bald nicht mehr gibt. Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand? Der Schweizer Sinn fürs Reale?
Die EU hat den Friedennobelpreis erhalten. Ihr Kommentar?
Hankel: Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Seit wir den Euro haben, nehmen die Gehässigkeiten und Animositäten unter den europäischen Völkern in einem erschreckenden Ausmass zu. Die zu rettenden Euroländer haben sich nicht gerade überschwänglich für die vielen hundert Milliarden Euro, die sie als Hilfe erhalten haben, bedankt. Bei den nächsten Milliarden werden sie es auch nicht tun. Ich kann nicht nachvollziehen, was sich das Nobelpreiskomitee bei der Verleihung dieses Preises gedacht hat. Nicht die EU sichert den Frieden Europas, sondern die Einsicht, dass man einen Dritten Weltkrieg weder braucht noch bezahlen könnte.
2012 in review
/in Zwischendurch!Die WordPress.com-Statistik-Elfen fertigten einen Jahresbericht dieses Blogs für das Jahr 2012 an.
Hier ist ein Auszug:
600 Personen haben 2012 den Gipfel des Mount Everest erreicht. Dieser Blog hat 2012 über 4.100 Aufrufe bekommen. Hätte jede Person, die den Gipfel des Mount Everest erreicht hat, diesen Blog aufgerufen, würde es 7 Jahre dauern, um so viele Aufrufe zu erhalten.
Zwischendurch!
/in Zwischendurch!Der risikolose Zins – ein Paradoxon
Sie wissen natürlich was ein Paradoxon ist. Sie haben damals in Mathe und Philo aufgepasst und wissen, dass es sich um einen unauflöslichen Widerspruch handelt. Soweit so gut. Später wurden uns in Lehranstalten – Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften – zahlreiche Kapitalmarkttheorien eingepaukt, die einen risikolosen Zins enthalten. Theoretisch. Nach diesen Modellen werden weltweit Unsummen gemanagt in der festen Annahme, es gäbe einen Zins ohne Risiko. Und genau hier liegt das Paradoxon.
Gäbe es kein Risiko, stellt sich die Frage, warum dann ein Zins erhoben werden sollte. Zugegeben, eine zunächst vereinfachte Sicht der Dinge, ebenso vereinfacht wie die Annahme eines risikolosen Zinses im Formelwerk der Kapitalmarkttheoretiker. Für die Beweisführung genügt ein Blick in die Vergangenheit, um festzustellen, dass keine einzige Geldanlage jedes Krisenszenario unbeschadet überlebt hat – sei es die Hyperinflation nach dem ersten Weltkrieg, die Währungsreform nach dem zweiten Weltkrieg oder das Goldverbot in den dreißiger Jahren. Auch damals ist man von einem bestimmten Risikoverständnis und in der Folge von einer Risikogewichtung ausgegangen, die sich im Nachhinein als unbrauchbar erwiesen hat.
Vom risikolosen Zins kann also keine Rede sein, streng genommen gab es nie einen. Leider wird dieses in der Wissenschaft nur langsam begriffen und folglich in der Finanzwirtschaft noch langsamer umgesetzt. Anleger, egal ob privat oder institutionell, suchen heute mehr denn je den sicheren Hafen, unabhängig davon, dass dieser gegebenenfalls im sagenumwobenen Atlantis liegen könnte. Oder wie erklären Sie sich den massiven und leider oft kritiklosen Mittelzufluss in scheinbar sichere Geldanlagen wie Sparbücher, Geldmarktkonten oder Staatsanleihen, die einen scheinbar risikolosen Zins bieten und hinter denen oft Emittenten (Schuldner) stecken, die gerade mit massivem Steuermitteleinsatz am Leben erhalten werden oder selbst für den Ausfall anderer bürgen müssen?
Wenn man eines aus der Finanzkrise ziehen kann, dann die Erkenntnis und leider auch die bitter bezahlte Erfahrung, dass es ausnahmslos keine risikolose Anlage gibt und schon gar nicht einen Zins ohne Risiko. Es kommt vielmehr darauf an, eine Geldanlage vor dem Hintergrund des aktuell herrschenden wirtschaftlichen und politischen Umfeldes nach dem Risikopotential zu untersuchen. Und so kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass sowohl Berater als auch Kunde sich entscheiden müssen, welche konkreten Risiken sich auf die Geldanlage aktuell auswirken könnten und welche Aufmerksamkeit man diesen Risiken bei der Anlageentscheidung beimessen möchte. Wichtig dabei ist, diesen Prozess laufend zu aktualisieren und wahrscheinliche Risikoszenarien mit dem „gefühlten“ Risikoempfinden des Kunden abzugleichen.
Aktuell kann man das viel diskutierte Inflationsrisiko in der Beratung thematisieren und prüfen, in wie weit der Kunde dieses im Anlageprozess berücksichtigen möchte, unabhängig davon, dass man zu Inflationsprognosen konträrer Meinung sein kann. Nähme man einen enormen Preisanstieg als ein wahrscheinliches Szenario an, wäre die Frage gestattet, warum man gerade in Anlagen mit vermeintlich risikolosem Zins investiert ist.
Fazit: Sollte Ihnen wieder einmal ein risikoloser Zins begegnen, so untersuchen Sie diesen anhand möglicher Risikoszenarien (z.B. Inflation, Staatspleite, Währungsreform etc.) und schauen, was von der vermeintlichen Sicherheit übrig bleibt. Des Weiteren kann man einfach akzeptieren, dass es immer unkalkulierbare Risiken im Geldanlagegeschäft geben wird und man diese nicht eliminieren kann. So hat auch ein mit dem Nobelpreis geehrter Wirtschaftwissenschaftler und Kapitalmarkttheoretiker (s)einen pragmatischen Weg gefunden (abseits der eigenen Theorie): auf die Frage, wie denn der private Harry Markowitz sein Geld anlegen würde, antwortete dieser nur: „50% Aktien und 50% Anleihen“. So einfach kann es gehen. Paradox, oder?
Vladimir Skendzic, Investment Manager, Skandia
Zwischendurch!
/in Zwischendurch!Ein Jahr Euro-Peg: War es das für den Franken?

Jahrzehntelang konnten Schweizer und an Kapitalerhalt interessierte Ausländer ohne Nachzudenken auf den Franken setzen. Das ist vorbei. Ein Jahr Euro-Rettung hat den Franken ruiniert.
Vor rund einem Jahr passierte das bis dato Undenkbare: Die Schweizer Notenbank preschte mit einem Coup de Force vor, band den Franken zum Mindestkurs an den Euro. Sie nahm damit Devisentradern, die gegen den Euro spekulierten, den Wind aus den Segeln.
Die Festanbindung einer Währung an eine andere nennt sich in der Fachsprache „Peg“. Seit rund einem Jahr kauft die Schweizer Notenbank zum Preis von 1,20 jeden Euro auf, der in die Schweiz will. Da es kaum Franken-Besitzer gibt, die zu diesem Kurs Euros kaufen wollen, muss die Notenbank den Markt ersetzen: Sie erschafft die benötigten Franken aus dem Nichts. Ohne diese Aktion der Notenbank würde der Franken aufwerten.
Kurzfristig war es durchaus eine interessante Idee, Devisenspekulanten mit einem Peg zu verschrecken. Doch das Problem der Schweizer Währungshüter sind inzwischen nicht mehr kurzfristig engagierte Devisentrader, sondern langfristig orientiertes Fluchtkapital aus der Euro-Peripherie. Die Notenbank fand auf diese Herausforderung keine Antwort. „Wie viele Fränkli hätten´s denn gerne?“ Die Anleger bekommen frisch erschaffene Franken, in den Depots der Schweizer Notenbank sammelt sich das, was Euro-Anleger loswerden wollen: Euros.
Anfang August 2012 vermeldete die offizielle Statistik der Schweizer Notenbank Devisenreserven in Höhe von 406,5 Mrd. Franken, bzw. 417,7 Mrd. US-Dollar.

Zum Vergleich: Großbritannien besitzt 27,9 Mrd. Dollar Devisenreserven, Schweden blickt auf 48 Mrd. Dollar, Argentinien hat 52 Mrd. Dollar, Polen 86 Milliarden Dollar.
Im Mai 2012 entsprach die Summe der Devisenkäufe der Notenbank SNB dem Umfang der Schweizer Exporterlöse eines Jahres. Devisenmarkt und Realwirtschaft verhalten sich größenmäßig wie Elefant und Maus. Um Verwechslungen zu vermeiden: Die Maus, das ist die Realwirtschaft.

Bei den Währungsreserven pro Kopf der Bevölkerung toppt die Schweiz selbst den weltgrößten Devisenbesitzer China. Einstmals waren Devisenreserven der Stolz einer Nation und zeugten von einem Handelsüberschuss mit dem Ausland. Reserven in ausländischer Währung konnten genutzt werden, falls die eigene Währung verteidigt werden musste.
Heute deuten hohe Devisenreserven eher darauf hin, dass die Landeswährung künstlich geschwächt wird. Südkorea, Japan und China häuften Devisenreserven an, um Exporte zu subventionieren.
Wie hoch sollten die Devisenreserven eines westlichen Industriestaates heute sein? Deutschland besaß 2006 Devisenreserven im Umfang von 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Die Schweiz besitzt Devisenreserven in Höhe von 72,7 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes.
Das Peg-Experiment ist missglückt. Mit negativen Zinsen für Ausländer wie in den 70ern wäre die Schweiz besser gefahren. Die riesigen Devisenreserven haben aus der Schweizer Notenbank so etwas wie einen gigantischen Staatsfond gemacht. Falls die Fond-Manager mit ihrer „Anlagestrategie“ falsch liegen, wird die Währung weich. Für DIE Schweizer, die ihre Ersparnisse in Franken gespeichert haben (fast alle?), geht dann Kaufkraft verloren.
Der Franken der Zukunft wird im besten Fall so etwas wie die Schwedenkrone in den 90ern sein: Ein volatiler Wackelpudding. Die Industrie kommt damit klar, für Rentner ist so eine Währung ein Alptraum. Und das Szenario „Schwedenkrone“ ist hier wirklich noch der Best Case.
Die Schweizer Währungshüter haben in den kommenden Wochen einen letzte Chance: Sie müssten in einer Nacht- und Nebelaktion werthaltige Assets oder Optionen auf werthaltige Assets erwerben – weltweit: das könnte Gold sein und in Ermangelung von Gold auch Goldminenaktien und Goldoptionsscheine.
Dann wäre die aufgeblähte Geldmenge gedeckt. Es gibt Berichte, dass die Schweizer Notenbank ihre Euro-Positionen reduziert und sogar Schwedenkronen und australische Dollar kauft. Das geht in die richtige Richtung, dürfte aber kaum wirklich konsequent gemacht werden.
Am Ende muss jedem Schweizer und jedem Frankenanleger gesagt werden, dass es naiv wäre, der Notenbank an dieser Stelle allzu viel Tatkraft zu unterstellen. Auf der Agenda der Notenbanker stehen ganz andere Probleme.
„Raus aus dem Franken?“ – Ja, aber ohne jede Eile. Die Euro-Krise bindet derzeit das Maximum der weltweiten Aufmerksamkeit und verhindert die Fokussierung auf andere Probleme. Auch die USA haben deftige Probleme. Die Tage, an denen die Märkte erkennen werden, dass die Schweizer Währungshüter den Franken zerstört haben, sind noch nicht gekommen.
Irgendwann werden die Märkte ihre Meinung über den Franken ändern. Dann sollte man nicht mehr allzu viel Kapital im Franken haben. Was tun mit den Franken? Gold ist bei den Franken-Alternativen eine der allerersten Adresse, aber nicht die einzige. Langfristig ist gerade die Schweiz ein besonders interessanter Standort für echte Neuinvestitionen in Produktivkapital.
Das wahre Kapital der Schweiz ist nicht der Franken, sondern der im Land aufgebaute „Kapitalstock“: das Produktivkapital, die Rechtssicherheit, ein offensichtlich funktionierendes Staatswesen, kurz: die Schweiz und die Schweizer selbst. Die Perspektive einer Währungskrise oder einer schlappen Weichwährung mag für die Schweizer erschreckend erscheinen, es gibt jedoch Schlimmeres.
Hier hilft ein Blick nach Finnland. Die finnische Wirtschaft war vierzig Jahre lang sehr eng mit der sowjetischen Wirtschaft verzahnt. Finnland brach nach dem Kollaps der Sowjetunion wirtschaftlich zusammen – aber nicht politisch. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 20 Prozent, die Währung taumelte – aber Finnland erfand sich neu. In dieser Zeit wurde aus Nokia, dem Hersteller von Gummistiefeln und Forsttechnik, ein Hersteller von Mobilfunk-Netzen und schicken Handys.
Es klingt etwas abgegriffen, aber jede Krise ist auch eine Chance.
Bei einem Zusammenbruch der Euro-Zone würde die Schweiz das Schicksal Finnlands teilen und in eine Depression rutschen, die Währung würde sehr viel Wert verlieren. In der Realwirtschaft könnten sich jedoch Chancen bieten. Unternehmer brauchen keine niedrigen Steuersätze, sondern Rechtssicherheit. Wenn in Italien die Finanzpolizei florierende Unternehmen wochenlang besetzt und die Produktion zum vollständigen Erliegen bringt, dann bietet sich für Firmen in rechtsstaatlich organisierten Ländern eine Chance, Marktanteile zu gewinnen.
Irgendwann könnte es richtig interessant werden, in der Schweiz in echtes Produktivkapital zu investieren. Bis dahin gibt es zu Edelmetallen erstaunlich wenige Alternativen.
Rechnen wir einmal, ein Schweizer hätte heute ein Bargeldvermögen in Höhe von einer Million Franken. Vermuten wir einmal, der Franken würde innerhalb von 10 Jahren rund 40 Prozent abwerten, während sich der Goldpreis in dieser Zeit verdreifacht.
Der Anleger belässt eine halbe Million seines Vermögens in verzinsten Franken-Anleihen. In der Schweiz nennt man die „Obligationen“, Verpflichtungen. Über zehn Jahre gewinnt der Anleger 55.000 Franken an Zinsen, elf Prozent. Eine halbe Million tauscht der Anleger in Gold. In diesem Fall würde der Anleger nach zehn Jahren über ein Nominalvermögen von 2,055 Mio. Franken verfügen. Diese Franken hätten aber nur noch 60 Prozent der Kaufkraft von heute. Wegen des hohen Goldanteils hätte der Anleger jedoch für das Gesamtvermögen einen Kaufkraftzugewinn von 23 Prozent erzielt.
Falls der Anleger nur zehn Prozent seines Vermögens in Gold anlegt und sich der Goldpreis nur verdoppelt, dann besäße er nach zehn Jahren noch 78 Prozent seines alten Vermögens.
Für Schweizer ist das alles natürlich schwer vorstellbar, doch dem Vorstellungsvermögen lässt sich mit einem Blick nach Schweden auf die Sprünge helfen. Schweden sind genau so fleißig und gemütlich wie Schweizer, die Schweden haben eine Währungs- und Bankenkrise mit nachfolgender Geldentwertung schon hinter sich.
„Pappas Pengar“ – „Papas Geld“ heißt eine Daily Soap, die in Schweden Kultstatus genießt. Die Serie handelt von der angeblich reichsten Familie Schwedens. Die Familie erstickt im Geld, scheitert aber zur Gaudi des Publikums am realen Leben. Wie Volltrottel stolpern die Ultra-Reichen durch ihr luxuriöses Leben. Das schwedische Fernsehpublikum, zum größten Teil nicht mehr wohlhabend, ist begeistert.
„Vater, ab wann ist man eigentlich reich“, fragt der Sohn seinen Vater beim Quad-Ausflug durch den eigenen Wald. Der Vater wirkt sichtlich überfordert und sucht nach einer Antwort. „Also früher war man reich, wenn man eine Million Kronen hatte. Heute ist man reich, wenn man zehn Millionen Kronen hat.“ Der Sohn bohrt weiter. „Und warum sind wir reich?“ Diese Antwort weiß der Papa sofort: „Weil Opa an Hitler Stahl verkauft hat.“
Dieser kurze Dialog erzählt mehr über Schweden als die Romane von Inga Lindström, die das ZDF am Sonntagabend zeigt. Saftige Steuersätze und hohe Inflationsraten sorgen dafür, dass kein normaler schwedischer Arbeitnehmer irgendeine Art von Vermögen aufbauen kann. Wer Vermögen hat, der muss es mit üblen Geschäften gemacht haben, diese Denkweise geistert in vielen schwedischen Köpfen umher. 1994 oder 1995 publizierte das „Time“-Magazin einen wohlwollenden Artikel über die vermutlich reichste Familie Schwedens: die Wallenbergs. In der nächsten Ausgabe des Magazins schäumte ein schwedischer Leserbriefschreiber, dass in Schweden niemand Stolz auf die Wallenbergs sei.
FRÜHER war man in Schweden mit einer Million Kronen reich. NACH der Immobilienkrise, der Währungskrise und den Bankenrettungen braucht man in Schweden zehn Millionen Kronen, um reich zu sein.
Etwas Ähnliches steht nun auch reichen Frankenanlegern bevor. Zeit, um sich bei einer Tasse „Ovi“, dem Schweizer Nationalgetränk, Gedanken über die Zukunft zu machen.
Als Währung wird der Franken erhalten bleiben, als Tool zum Kaufkrafterhalt hat er ausgedient.
Die Londoner Goldbörse LMBA stellte am Freitag zum Nachmittagsfixing einen Goldpreis von 1776,00 Dollar bzw. 1377,28 Euro fest.
Quellen der Woche:
(Quelle: Carat Gold Shop)
Zwischendurch!
/in Zwischendurch!„So pünktlich und zuverlässig der Staat also auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg seine Zinsen für seine Schulden zahlen mag (allzuoft mit neuen,wiederum verzinslichen Krediten finanziert!), an irgendeiner Stelle platzt einmal der Ballon, mit oder ohne Revolution und Bürgerkrieg. Und was dann die Gläubiger noch erhalten werden, gehört in das Reich der Spekulation, die wir anderen überlassen werden.“ Prof.Issing am 06.03.1992(damals Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank)in einem Vortrag in Innsbruck.
Interessante Links
Hier finden Sie ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Webseite :)Seiten
Kategorien
Archiv
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011