Zwischendurch!
Ein Jahr Euro-Peg: War es das für den Franken?

Jahrzehntelang konnten Schweizer und an Kapitalerhalt interessierte Ausländer ohne Nachzudenken auf den Franken setzen. Das ist vorbei. Ein Jahr Euro-Rettung hat den Franken ruiniert.
Vor rund einem Jahr passierte das bis dato Undenkbare: Die Schweizer Notenbank preschte mit einem Coup de Force vor, band den Franken zum Mindestkurs an den Euro. Sie nahm damit Devisentradern, die gegen den Euro spekulierten, den Wind aus den Segeln.
Die Festanbindung einer Währung an eine andere nennt sich in der Fachsprache „Peg“. Seit rund einem Jahr kauft die Schweizer Notenbank zum Preis von 1,20 jeden Euro auf, der in die Schweiz will. Da es kaum Franken-Besitzer gibt, die zu diesem Kurs Euros kaufen wollen, muss die Notenbank den Markt ersetzen: Sie erschafft die benötigten Franken aus dem Nichts. Ohne diese Aktion der Notenbank würde der Franken aufwerten.
Kurzfristig war es durchaus eine interessante Idee, Devisenspekulanten mit einem Peg zu verschrecken. Doch das Problem der Schweizer Währungshüter sind inzwischen nicht mehr kurzfristig engagierte Devisentrader, sondern langfristig orientiertes Fluchtkapital aus der Euro-Peripherie. Die Notenbank fand auf diese Herausforderung keine Antwort. „Wie viele Fränkli hätten´s denn gerne?“ Die Anleger bekommen frisch erschaffene Franken, in den Depots der Schweizer Notenbank sammelt sich das, was Euro-Anleger loswerden wollen: Euros.
Anfang August 2012 vermeldete die offizielle Statistik der Schweizer Notenbank Devisenreserven in Höhe von 406,5 Mrd. Franken, bzw. 417,7 Mrd. US-Dollar.

Zum Vergleich: Großbritannien besitzt 27,9 Mrd. Dollar Devisenreserven, Schweden blickt auf 48 Mrd. Dollar, Argentinien hat 52 Mrd. Dollar, Polen 86 Milliarden Dollar.
Im Mai 2012 entsprach die Summe der Devisenkäufe der Notenbank SNB dem Umfang der Schweizer Exporterlöse eines Jahres. Devisenmarkt und Realwirtschaft verhalten sich größenmäßig wie Elefant und Maus. Um Verwechslungen zu vermeiden: Die Maus, das ist die Realwirtschaft.

Bei den Währungsreserven pro Kopf der Bevölkerung toppt die Schweiz selbst den weltgrößten Devisenbesitzer China. Einstmals waren Devisenreserven der Stolz einer Nation und zeugten von einem Handelsüberschuss mit dem Ausland. Reserven in ausländischer Währung konnten genutzt werden, falls die eigene Währung verteidigt werden musste.
Heute deuten hohe Devisenreserven eher darauf hin, dass die Landeswährung künstlich geschwächt wird. Südkorea, Japan und China häuften Devisenreserven an, um Exporte zu subventionieren.
Wie hoch sollten die Devisenreserven eines westlichen Industriestaates heute sein? Deutschland besaß 2006 Devisenreserven im Umfang von 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Die Schweiz besitzt Devisenreserven in Höhe von 72,7 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes.
Das Peg-Experiment ist missglückt. Mit negativen Zinsen für Ausländer wie in den 70ern wäre die Schweiz besser gefahren. Die riesigen Devisenreserven haben aus der Schweizer Notenbank so etwas wie einen gigantischen Staatsfond gemacht. Falls die Fond-Manager mit ihrer „Anlagestrategie“ falsch liegen, wird die Währung weich. Für DIE Schweizer, die ihre Ersparnisse in Franken gespeichert haben (fast alle?), geht dann Kaufkraft verloren.
Der Franken der Zukunft wird im besten Fall so etwas wie die Schwedenkrone in den 90ern sein: Ein volatiler Wackelpudding. Die Industrie kommt damit klar, für Rentner ist so eine Währung ein Alptraum. Und das Szenario „Schwedenkrone“ ist hier wirklich noch der Best Case.
Die Schweizer Währungshüter haben in den kommenden Wochen einen letzte Chance: Sie müssten in einer Nacht- und Nebelaktion werthaltige Assets oder Optionen auf werthaltige Assets erwerben – weltweit: das könnte Gold sein und in Ermangelung von Gold auch Goldminenaktien und Goldoptionsscheine.
Dann wäre die aufgeblähte Geldmenge gedeckt. Es gibt Berichte, dass die Schweizer Notenbank ihre Euro-Positionen reduziert und sogar Schwedenkronen und australische Dollar kauft. Das geht in die richtige Richtung, dürfte aber kaum wirklich konsequent gemacht werden.
Am Ende muss jedem Schweizer und jedem Frankenanleger gesagt werden, dass es naiv wäre, der Notenbank an dieser Stelle allzu viel Tatkraft zu unterstellen. Auf der Agenda der Notenbanker stehen ganz andere Probleme.
„Raus aus dem Franken?“ – Ja, aber ohne jede Eile. Die Euro-Krise bindet derzeit das Maximum der weltweiten Aufmerksamkeit und verhindert die Fokussierung auf andere Probleme. Auch die USA haben deftige Probleme. Die Tage, an denen die Märkte erkennen werden, dass die Schweizer Währungshüter den Franken zerstört haben, sind noch nicht gekommen.
Irgendwann werden die Märkte ihre Meinung über den Franken ändern. Dann sollte man nicht mehr allzu viel Kapital im Franken haben. Was tun mit den Franken? Gold ist bei den Franken-Alternativen eine der allerersten Adresse, aber nicht die einzige. Langfristig ist gerade die Schweiz ein besonders interessanter Standort für echte Neuinvestitionen in Produktivkapital.
Das wahre Kapital der Schweiz ist nicht der Franken, sondern der im Land aufgebaute „Kapitalstock“: das Produktivkapital, die Rechtssicherheit, ein offensichtlich funktionierendes Staatswesen, kurz: die Schweiz und die Schweizer selbst. Die Perspektive einer Währungskrise oder einer schlappen Weichwährung mag für die Schweizer erschreckend erscheinen, es gibt jedoch Schlimmeres.
Hier hilft ein Blick nach Finnland. Die finnische Wirtschaft war vierzig Jahre lang sehr eng mit der sowjetischen Wirtschaft verzahnt. Finnland brach nach dem Kollaps der Sowjetunion wirtschaftlich zusammen – aber nicht politisch. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 20 Prozent, die Währung taumelte – aber Finnland erfand sich neu. In dieser Zeit wurde aus Nokia, dem Hersteller von Gummistiefeln und Forsttechnik, ein Hersteller von Mobilfunk-Netzen und schicken Handys.
Es klingt etwas abgegriffen, aber jede Krise ist auch eine Chance.
Bei einem Zusammenbruch der Euro-Zone würde die Schweiz das Schicksal Finnlands teilen und in eine Depression rutschen, die Währung würde sehr viel Wert verlieren. In der Realwirtschaft könnten sich jedoch Chancen bieten. Unternehmer brauchen keine niedrigen Steuersätze, sondern Rechtssicherheit. Wenn in Italien die Finanzpolizei florierende Unternehmen wochenlang besetzt und die Produktion zum vollständigen Erliegen bringt, dann bietet sich für Firmen in rechtsstaatlich organisierten Ländern eine Chance, Marktanteile zu gewinnen.
Irgendwann könnte es richtig interessant werden, in der Schweiz in echtes Produktivkapital zu investieren. Bis dahin gibt es zu Edelmetallen erstaunlich wenige Alternativen.
Rechnen wir einmal, ein Schweizer hätte heute ein Bargeldvermögen in Höhe von einer Million Franken. Vermuten wir einmal, der Franken würde innerhalb von 10 Jahren rund 40 Prozent abwerten, während sich der Goldpreis in dieser Zeit verdreifacht.
Der Anleger belässt eine halbe Million seines Vermögens in verzinsten Franken-Anleihen. In der Schweiz nennt man die „Obligationen“, Verpflichtungen. Über zehn Jahre gewinnt der Anleger 55.000 Franken an Zinsen, elf Prozent. Eine halbe Million tauscht der Anleger in Gold. In diesem Fall würde der Anleger nach zehn Jahren über ein Nominalvermögen von 2,055 Mio. Franken verfügen. Diese Franken hätten aber nur noch 60 Prozent der Kaufkraft von heute. Wegen des hohen Goldanteils hätte der Anleger jedoch für das Gesamtvermögen einen Kaufkraftzugewinn von 23 Prozent erzielt.
Falls der Anleger nur zehn Prozent seines Vermögens in Gold anlegt und sich der Goldpreis nur verdoppelt, dann besäße er nach zehn Jahren noch 78 Prozent seines alten Vermögens.
Für Schweizer ist das alles natürlich schwer vorstellbar, doch dem Vorstellungsvermögen lässt sich mit einem Blick nach Schweden auf die Sprünge helfen. Schweden sind genau so fleißig und gemütlich wie Schweizer, die Schweden haben eine Währungs- und Bankenkrise mit nachfolgender Geldentwertung schon hinter sich.
„Pappas Pengar“ – „Papas Geld“ heißt eine Daily Soap, die in Schweden Kultstatus genießt. Die Serie handelt von der angeblich reichsten Familie Schwedens. Die Familie erstickt im Geld, scheitert aber zur Gaudi des Publikums am realen Leben. Wie Volltrottel stolpern die Ultra-Reichen durch ihr luxuriöses Leben. Das schwedische Fernsehpublikum, zum größten Teil nicht mehr wohlhabend, ist begeistert.
„Vater, ab wann ist man eigentlich reich“, fragt der Sohn seinen Vater beim Quad-Ausflug durch den eigenen Wald. Der Vater wirkt sichtlich überfordert und sucht nach einer Antwort. „Also früher war man reich, wenn man eine Million Kronen hatte. Heute ist man reich, wenn man zehn Millionen Kronen hat.“ Der Sohn bohrt weiter. „Und warum sind wir reich?“ Diese Antwort weiß der Papa sofort: „Weil Opa an Hitler Stahl verkauft hat.“
Dieser kurze Dialog erzählt mehr über Schweden als die Romane von Inga Lindström, die das ZDF am Sonntagabend zeigt. Saftige Steuersätze und hohe Inflationsraten sorgen dafür, dass kein normaler schwedischer Arbeitnehmer irgendeine Art von Vermögen aufbauen kann. Wer Vermögen hat, der muss es mit üblen Geschäften gemacht haben, diese Denkweise geistert in vielen schwedischen Köpfen umher. 1994 oder 1995 publizierte das „Time“-Magazin einen wohlwollenden Artikel über die vermutlich reichste Familie Schwedens: die Wallenbergs. In der nächsten Ausgabe des Magazins schäumte ein schwedischer Leserbriefschreiber, dass in Schweden niemand Stolz auf die Wallenbergs sei.
FRÜHER war man in Schweden mit einer Million Kronen reich. NACH der Immobilienkrise, der Währungskrise und den Bankenrettungen braucht man in Schweden zehn Millionen Kronen, um reich zu sein.
Etwas Ähnliches steht nun auch reichen Frankenanlegern bevor. Zeit, um sich bei einer Tasse „Ovi“, dem Schweizer Nationalgetränk, Gedanken über die Zukunft zu machen.
Als Währung wird der Franken erhalten bleiben, als Tool zum Kaufkrafterhalt hat er ausgedient.
Die Londoner Goldbörse LMBA stellte am Freitag zum Nachmittagsfixing einen Goldpreis von 1776,00 Dollar bzw. 1377,28 Euro fest.
Quellen der Woche:
(Quelle: Carat Gold Shop)
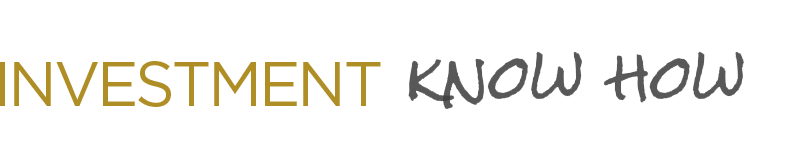
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!